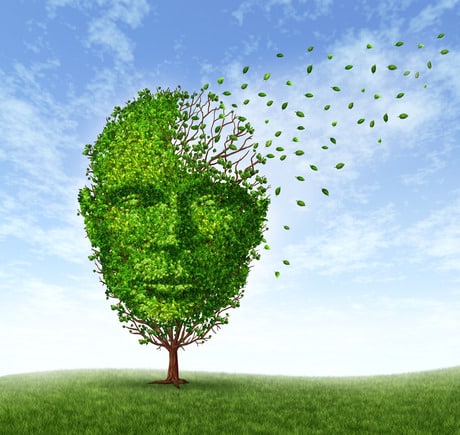Die Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und des Begriffs der Pflegebedürftigkeit sind schon lange ein kontrovers diskutiertes Thema – viele empfanden die „Pflegebedürftigkeit“ im Rahmen der „altbekannten“ Pflegestufen als zu eng definiert. Wesentliche Aspekte, wie kognitive und psychische Beeinträchtigungen, insbesondere bei Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, fanden hier keine oder lediglich eine unzureichende Berücksichtigung.
Heute stellen wir Ihnen das Neue Begutachtungsassessment vor, welches im Rahmen des Pflegestärkungsgesetz II, ab 01.01.2017 Anwendung findet.
Das Neue Begutachtungsassessment
Ab 1. Januar 2017 werden die bisher bekannten Pflegestufen durch fünf Pflegegrade ersetzt.
Dabei sind die Begrifflichkeiten „Selbstständig“, „Überwiegend selbstständig“, „Überwiegend unselbstständig“ und „Unselbstständig“ zu unterscheiden.
„Selbstständig“ bedeutet, dass die Person Aktivitäten grundsätzlich alleine durchführen kann, jedoch zur Durchführung Hilfsmittel benötigt werden – oder sich die Aktivitäten nur schwerlich oder verlangsamt umsetzen lassen. Die Person ist in dieser Stufe der Selbstständigkeit allerdings nicht auf fremde Unterstützung angewiesen. Treten Beeinträchtigungen lediglich kurzzeitig oder vereinzelt auf, finden diese keine Berücksichtigung.
Wer als „überwiegend selbstständig“ eingestuft wird, kann Handlungen größtenteils selbst ausführen und ist nur in Einzelfällen auf Unterstützung angewiesen. Der Begriff „Unterstützung“ bedeutet in diesem Fall, dass motivierende Impulse gegeben oder Gegenstände entsprechend zurechtgelegt werden.
„Überwiegend unselbstständig“ ist, wer Aktivitäten größtenteils nicht selbst ausführen kann und personelle Unterstützung benötigt – allerdings in der Lage ist, sich daran aktiv zu beteiligen. Einzelne Handlungsschritte müssen übernommen werden und Anleitungen sind notwendig.
Kann eine Person Aktivitäten auch nicht teilweise selbständig ausführen oder steuern, wird von der „Unselbständigkeit“ gesprochen. Unterstützung wird bei nahezu allen Handlungen benötigt.
Die Eingliederung in Pflegegrade erfolgt, im Rahmen des Neuen Begutachtungsassessments, durch eine Punktevergabe auf Basis von sechs verschiedenen Modulen.
Aktivitätsbereiche im Neuen Begutachtungsassessment
- Mobilität: Körperliche Beweglichkeit, also zum Beispiel, ob sich die Person selbständig in dem eigenen Wohnbereich fortbewegen kann.
- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Versteht die Person Sachverhalte, kann sie Risiken erkennen, mit anderen Gespräche führen und sich zeitlich sowie räumlich orientieren?
- Selbststeuerungskompetenz / Verhalten und psychische Problemlagen: Hat die Person mit Ängsten und/oder Aggressionen zu tun, die für die Umwelt (Pflegepersonen/Angehörige) oder sich selbst „gefährlich“ werden können? Leidet darunter die Durchführung pflegerischer Maßnahmen?
- Fähigkeit zur Selbstversorgung: Inwieweit ist die Person in der Lage, selbstständig die Körperpflege durchzuführen, Nahrungsmittel und Getränke zu zu bereiten und zu verzehren, kann sie sich ankleiden und die Toilette aufsuchen?
- Bewältigung von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen / Belastungen: Ist die Person in der Lage, selbst Medikamente einzunehmen oder notwendige Therapien, wie regelmäßiges Blutdruckmessen, selbst durchzuführen? Kann sie einschätzen, ob sie Hilfsmittel benötigt oder ein (Fach-)Arzt aufgesucht werden muss?
- Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte: Verfügt die Person über die Fähigkeit, den Alltag selbst zu gestalten, Kontakte zu Mitmenschen zu pflegen oder Hobbies ohne Hilfe nachzugehen?
Überprüfung der Aktivitätsbereiche
Die Überprüfung dieser sechs Aktivitätsbereiche soll die Selbstständigkeit der begutachteten Person feststellen. All diese Aspekte werden bei dem neuen Begutachtungsassessment berücksichtigt, dabei jedoch unterschiedlich stark gewichtet.
Die folgennde Grafik stellt die jeweiligen Anteile der Module in Prozent dar. Die Module 2 und 3 sind zusammengefasst.
a) Nur das Modul mit dem höheren Wert wird für die Bewertung berücksichtigt
b) Mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung
Zwei weitere Bereiche, nämlich „Außerhäusliche Aktivitäten“ und „Haushaltsführung“, werden im Rahmen der Bewertung nicht herangezogen. Allerdings ermöglichen sie Pflegeberatern, sich im Hinblick auf die pflegebedürftige Person über weitere zur Verfügung stehende Sozialleistungen oder nützliche Angebote zu informieren oder einen individuellen Versorgungsplan auszuarbeiten.
Zu den „Außerhäuslichen Aktivitäten“ zählt, ob sich die Person selbstständig in der Öffentlichkeit zurechtfindet, öffentliche Verkehrsmittel nutzen kann und zum Beispiel problemlos an Veranstaltungen teilnehmen kann.
Im Hinblick auf die „Haushaltsführung“ wird die Selbstständigkeit bei Tätigkeiten rund um den Haushalt herangezogen – also beispielsweise beim Einkaufen oder der Regelung von wichtigen Behördengängen (z.B. Finanzamt).
In unserem nächsten Blogartikel geht es um die Umwandlung der Pflegestufen in Pflegegrade.